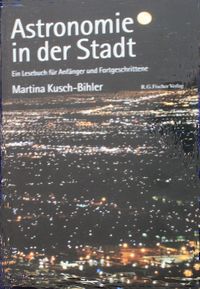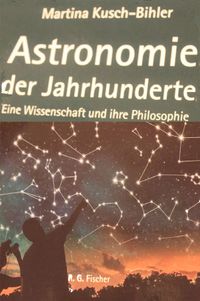Geschichte der Astronomie
Das Chandra-Röntgenteleskop
Das Chandra-Röntgenteleskop sucht nach den vielfältigen Röntgenquellen im All. Dazu gehören Supernovaüberreste, Doppelsterne und Schwarze Löcher. Die hochenergetischen Röntgenstrahlen werden leicht absorbiert. Der Wasserdampf in der Atmosphäre schirmt die Röntgenstrahlen aus dem All ab. Die Sonne sendet Röntgenstrahlen aus.
Entdeckung der Quasare und die Doctorandin Joyce Bell Burnell
Ende der fünfziger Jahre fanden Astrophysiker Radioquellen ohne sichtbare Objekte. Schließlich wurde ein schwacher Lichtpunkt gefunden, der als Quasar identifiziert wurde. Quasare sind schnell rotierende Neutronensterne, die Impulse oft im Millisekundenbereich aussenden. Später entdeckte man Quasare auch in Galaxien, aktive Kerne in Galaxien, in denen ein Schwarzes Loch die Sterne verschluckt. Doch zuerst dachte man bei der Entdeckung dieser Signale an außeridische Zivilisationen. 1967 war die Doctorantin Joyce Bell Burnell daran beteiligt, die Signale der Quasare auszuwerten. Leider musste der Glauben an grüne Männchen aufgegeben werden.
Sterne über Treptow - Die Berliner Archenhold-Sternwarte
Die Berliner Archenhold-Sternwarte ist die älteste Sternwarte Deutschlands. Vor 125 Jahren wurden dort Nebelflecken und das Zodiakallicht fotografiert. Friedrich Simon Archenhold (1861-1939) war Anfang der 1880er Jahre nach Berlin gekommen. Die Münchener Optikerwerkstatt Steinheil fertigte 1895 ein Fernrohr mit einem kleinen Öffnungsverhältnis von 1:30. Mit einem Objektivdurchmesser von 68 cm und einer Brennweite von 21 Metern war es das längste Fernrohr der Welt. Damit war das Fernrohr für die Beobachtung von Planeten, Sternhaufen und Mehrfachsystemen verwendbar, aber nicht mehr für die Beobachtung von Nebeln.